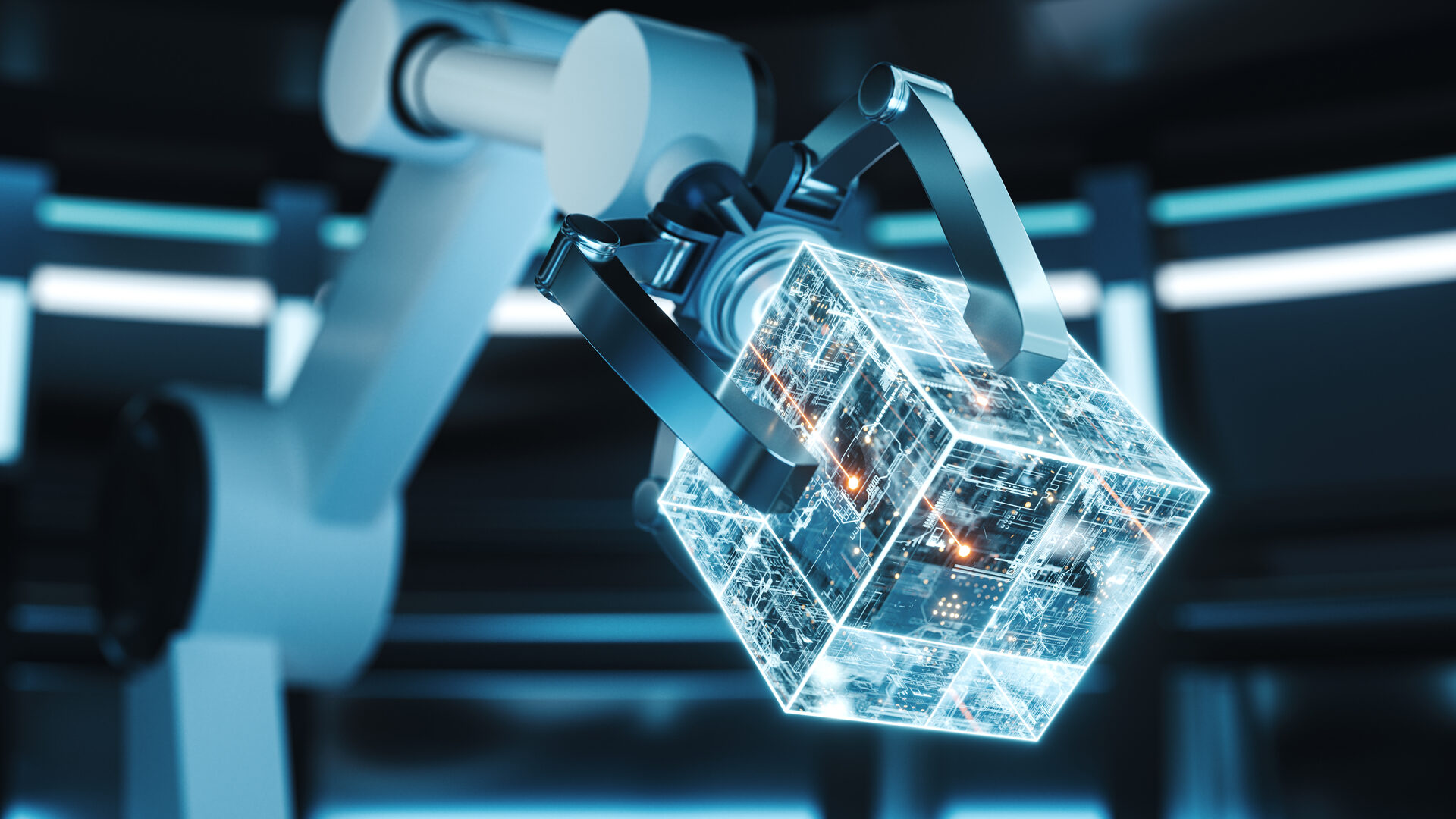
Technologische Zukunftsvisionen wie autonome Produktion in der Industrie 4.0, selbstfahrende Transportsysteme in der smarten Mobilität oder die Kopplung eines autonomen Energienetzes mit einer autonomen elektrifizierten Mobilität in einer smarten Stadt basieren auf technologischen Fortschritten durch Einzelwissenschaften. Dazu gehören Künstliche Intelligenz (KI) als Teilbereich der Informatik aber auch technologischen Errungenschaften anderer Disziplinen. Die Spezialisierungen sind jeweils notwendig, um etablierte Lösungen weiterzuentwickeln und damit die technologische Basis für die Umsetzung von Zukunftsvisionen zu schaffen.
Im Hinblick auf deren Umsetzung sind interdisziplinäre Kooperationen der Einzeldisziplinen allerdings unabdingbar und erweisen sich zunehmend als Flaschenhals. Bestehende fächerübergreifende Studienangebote zu Autonomen Systemen ergänzen interdisziplinäre Kooperationen wie die Mechatronik oder die Robotik um bestimmte (meist technische) Teilaspekte wie „vernetzte Intelligenz“ oder „intelligente Automatisierung“ für bestimmte Anwendungsbereiche wie autonome „Produktion“, autonomes „Fahren“ oder autonomes „Fliegen“. Wirtschaftswissenschaftliche, arbeitswissenschaftliche, rechtswissenschaftliche und andere nicht-technische Aspekte stehen dabei nicht im Fokus und werden eher in den entsprechenden nicht-technischen Disziplinen betrachtet. Dies motiviert die Einführung einer neuen, interdisziplinären Wissenschaftsdisziplin, der Autonomik. Diese erlaubt es, autonome Systeme ganzheitlich zu betrachten, zu entwickeln und einsetzen zu können, jeweils unter der Berücksichtigung der Hürden zur Umsetzung von Zukunftsvisionen. Da diese Hürden nicht rein technischer Natur sind, ist die Autonomik eine bereichsübergreifende Disziplin. Sie stellt die Grundlage für die Entwicklung und den Betrieb autonomer Systeme dar.